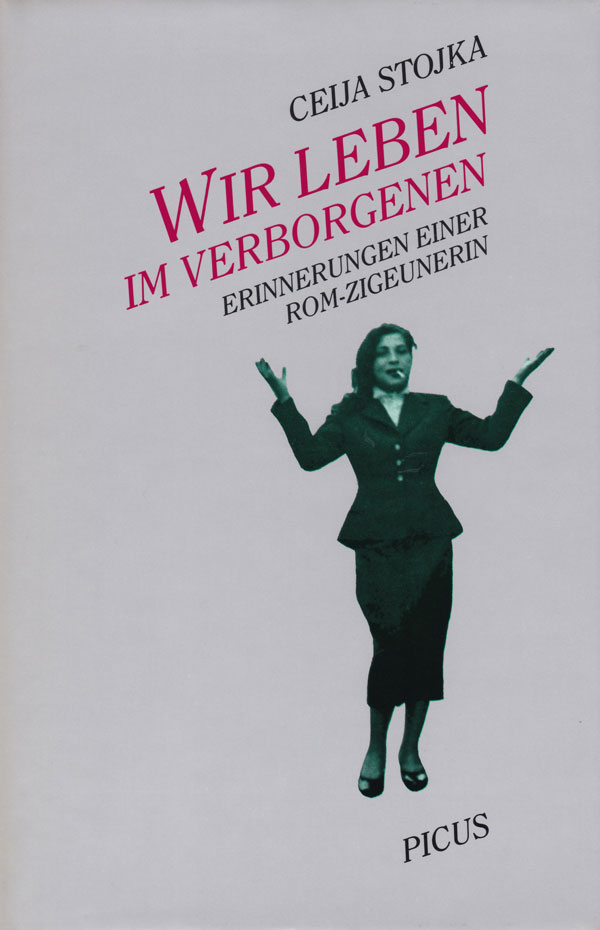 WIR LEBEN IM VERBORGENEN
WIR LEBEN IM VERBORGENEN
Erinnerungen einer Rom-Zigeunerin
Erstausgabe, Picus Wien 1988
In ihrer 1988 erstmals erschienenen, Aufsehen erregenden Autobiografie, die ein enormes Presseecho auslöste, erzählt Ceija Stojka in eindringlichen und unmittelbaren Worten, was sie als Kind in Auschwitz, Ravensbrück und Bergen-Belsen durchmachte. Ihre Aufzeichnungen waren die bis dahin ersten veröffentlichten Zeugnisse der Schrecken der Konzentrations- und Vernichtungslager aus dem Erleben der Sinti und Roma. Sie brach damit aber nicht nur das Schweigen über die Verfolgung dieser Minderheiten im Nationalsozialismus, sondern initiierte zudem einen Prozess der Auseinandersetzung mit der bis dahin fast unbekannten Lebensweise und Geschichte der ins Verborgene gedrängten Volksgruppen. Denn im zweiten Teil des Buches erzählt sie im Gespräch mit Karin Berger auch von der Zeit, als sie noch mit ihrer Familie durch Österreich reiste, ebenso wie über ihr Leben nach 1945, wie sie sich heute als Romni fühlt und davon, wie sie mit ihren Erinnerungen lebt.

1998 übersetzt ins Japanische

2006 übersetzt ins Niederländische:
WIJ LEVEN IN HET VERBORGENE.
Herinneringen van een Roma-Zigeunerin.
Van Gennep Amsterdam 2006

2008 übersetzt ins Tschechische:
ZIJEME VE SKRYTU.
Vyprávení rakouské Romky.
Übersetzung in das Tschechische. Argo

WIR LEBEN IM VERBORGENEN
Erinnerungen einer Rom-Zigeunerin
2003 4. Auflage
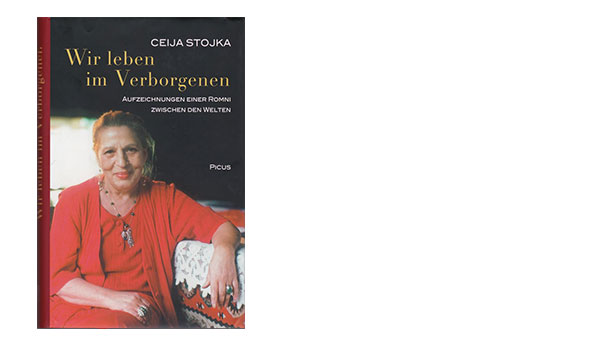
WIR LEBEN IM VERBORGENEN.
Aufzeichnungen einer Romni zwischen den Welten. Ceija Stojka, Herausgeberin Karin Berger. Überarbeitete Neuauflage inklusive dem zweiten autobiographischen Band „Reisende auf dieser Welt“ und einem Essay von Karin Berger „Reisen in die Kaiserstraße“
Picus Wien 2013
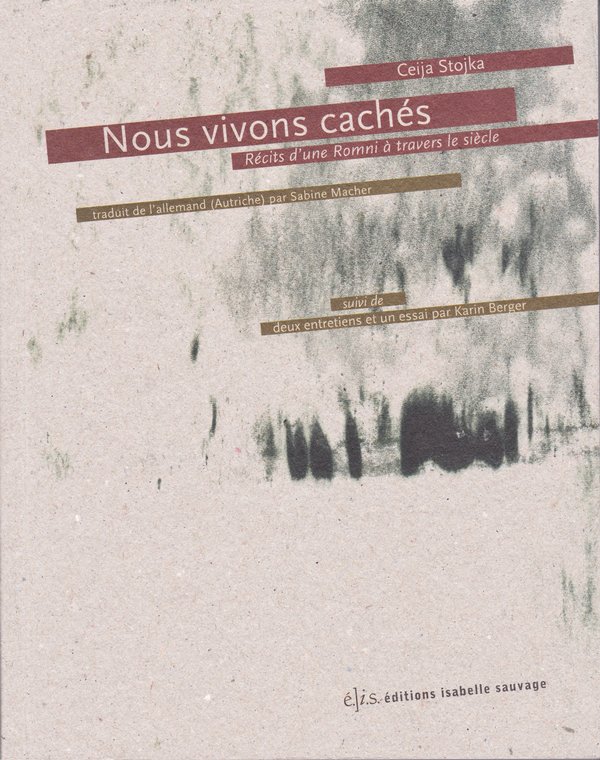
Nous vivons cachés. Récits d’une Romni à travers le siècle
Ceija Stojka, traduit par Sabine Macher, suivi de deux entretiens et un essai par Karin Berger, éditions isabelle sauvage, Plounéour-Ménez 2018
https://editionsisabellesauvage.fr

Vivimos ocultos. Memorias de una Romani entre los mundos.
Lasmigastambiensonpan / Colección Piedras en los bolsillos, 2022, traducción Pilar Mantilla
En su libro Vivimos ocultos, publicado por primera vez en 1988, Ceija Stojka describe sus experiencias de niña en los campos de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau, Ravensbrück y Bergen-Belsen. Sus apuntes fueron las primeras memorias de una gitana romaní en Austria sobre la persecución sufrida durante el nacionalsocialismo. Este libro fue la chispa que provocó en el seno de la sociedad austríaca que una parte de la población comenzara a enfrentarse a los crímenes del nacionalsocialismo. En aquel momento, la historia de los gitanos romaníes y sinti estaba excluida de la memoria pública.
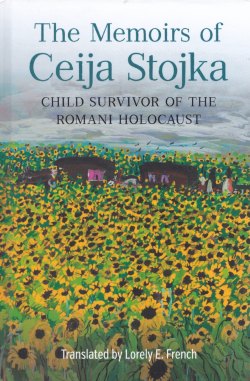
The Memoirs of Ceija Stojka, Child Survivor of the Romani Holocaust
by Ceija Stojka
Edited and translated by Lorely E. French
www.boydellandbrewer.com
First English translation of the memoirs of Austrian Romani Holocaust survivor, writer, visual artist, musician, and activist Ceija Stojka (1933-2013), along with poems, an interview, historical photos, and reproductions of her artworks.
PRESSE
(...) Ceija Stojka, die österreichische Roma, die als Kind nicht schreiben lernen durfte, schreibt wie ein Kind: unsentimental, unbeirrbar geradeaus und schecklich genau. Die “neue Heimat” , von der sie erzählt, heißt Auschwitz, danach kommen Ravensbrück und Bergen-Belsen: ein zwölfjähriges Kind, dem Hungertod nah, umringt von Leichenbergen, die ihm über den Kopf wachsen. ….
Sie ist eine stolze, starke Frau; ihr Buch richtet sich gegen Unterwerfung und Schweigen, gegen das “Leben im Verborgenen”, und was sie zu erzählen hat, ist außerordentlich.
DER SPIEGEL, Februar 1989
ERINNERUNGEN EINER ROM-ZIGEUNERIN
(...) In den Gesprächen erfährt man vieles von der unbeschwerten Kindheit, als die Großfamilie noch durch Österreich zog, und von den sich verdüsternden Zeiten nach 1938, als das Fahren den Zigeunern verboten wurde. Man erfährt auch, dass sich in den seit dem Krieg vergangenen vier Jahrzehnten nicht viel an den Vorurteilen gegenüber den Roma und Sinti geändert hat. Das führt dazu, dass sie lieber “im Verborgenen leben” und sich meist ungern zu erkennen geben. Es liegt aber in der Natur dieses Volkes, sich trotz allem das Leben ein wenig leichter zu machen. “Sie geniessen das Leben. Sie beschützen und lieben sich, und sie haben einen gewissen Stolz, sagt Ceija Stojka, die sich als Marktfahrerin durch das Leben schlug und die auch Lieder und Liedtexte schreibt. Ein ungewöhnliches Buch, das auch die traditionellen engen Bindungen in einer Zigeunerfamilie illustriert und deshalb auch in der Schweiz zur Kenntnis genommen werden sollte. E. H., NEUE ZÜRCHER ZEITUNG
Betroffen machen sollte uns aber auch der zweite Teil des Buches ein Interview der Herausgeberin mit Ceija Stojka. Hier erzählt sie die Geschichte ihrer Familie im demokratischen Österreich, vom ungebrochenen Fortbestehen von vorurteilen, Benachteiligungen und Abneigungen gegen eine ethnische Minderheit, die sich nicht assimilieren konnte oder wollte. Sie erzählt, wie Zigeunerinnen ihre Identität leugnen und sich als Jugoslawinnen oder Iranerinnen ausgeben müssen, um ihren Arbeitsplatz nicht zu verlieren. Trotzdem meint Ceija Stojka: „Aber wir müssen hinausgehen, wir müssen uns offnen, sonst kommt es noch so weit, dass irgendwann alle Romani in ein Loch hineinkippen.“
Maria Mesner, ZUKUNFT 1/89
ELEND IST DAS ZIGEUNERLEBEN
Auf der Operettenbühne werden sie gern gesehen und im Gstanzl gern besungen, ansonsten will keiner etwas mit ihnen zu tun haben, und dass Hitler sie nahezu ausrotten ließ, darüber sprich man nicht. Die Zigeuner passen nur dann in unsere Gesellschaft, wenn sie ihre Herkunft, ihre Sprache und auch die Leiden ihres Volkes verleugnen, sich anpassen und assimilieren. Auch das Bedenkjahr hat da nicht viel daran geändert. Eine von ihnen, Ceija Stojka, eine Romni, kann das Schweigen nicht mehr ertragen und schreibt ihre Erinnerungen auf. Erinnerungen an die Anfänge des Nationalsozialismus, das KZ, die schwere Zeit danach. Schreiben fällt ihr nicht leicht, das Reden auch nicht, aber sie verzichtet auf gedrechselte Sätze und politische Erläuterungen und auch auf Pathos und Sentiment, auf Selbstmitleid und Rachegeschrei. Dafür gibt sie allen ihren Brüdern und Schwestern eine Stimme, die – so leise sie ist – gehört werden muss.
dr, WOCHENPRESSE 12/ 24.3.1989
VON DER HÖLLE INS PURGATORIUM
Das Bedenkjahr ist vorüber, der Staat hat seine Pflicht getan, jetzt kann man weitermachen, gewonnen hat die Kirche. Es wurden Kränze abgelegt, es wurden Mahnreden gehalten, sogar das Protokoll hat man geschaukelt in dieser schweren Zeit. Doch eine Minute hat man geschwiegen im Hohen Haus. Das war die schönste Zeit des Jahres. Sonst aber haben sie sich das Maul zerrissen, die Repräsentanten öffentlicher Moral. Mit Schielen auf die ausländische Presse haben sie Erinnerung gefordert von jenen, die gern vergessen möchten und nicht können, weil die Erinnerung sie verfolgt bis auf den heutigen Tag. Denn nicht die Täter sind es, es sind Opfer, welche die Vergangenheit verfolgt. Auf ihrem Rücken wurde Aufarbeitung zum Spektakel, sogar der Streber in der Hofburg hat dafür Sendezeit verbraucht, urbi et orbi predigt er noch immer seine ewige Mitläufermoral. Schließlich will man europareif werden. Jetzt sind sie es alle zufrieden.
Schluß und Höhepunkt des Rummels ist contre Coeur die Enthüllung des Hrdlicka-Denkmals gewesen, mit dem die Aufklärung scheinbar triumphierte, indem sie sogar das Match um den Platz gewann. Tatsächlich triumphierte damit bloß die Sinnausbeutung der Opfer. Gegen “Krieg und Faschismus” soll das Mahnmal zeugen, gleich in einem Aufwasch, den es zur pikanten Pointe stilisiert: So geduldig ist der Stein. Es steht buchstäblich für die Leichen im Keller, für die echten und die metaphorischen, wie für jene, die in Auschwitz durch den Kamin gefahren sind. Ob einen die Nazis erschlugen oder die amerikanischen Bomben, ob man Opfer des Verbrechens war oder des Krieges gegen die Verbrecher, ein Opfer war man allemal. So wird die Volksgemeinschaft restituiert, diesmal für das Volk im kleinen. Was ein Mahnmal für Geschichte werden sollte, vernichtet Geschichte noch einmal, indem es den Toten die Geschichte ihres Todes raubt. Metaphysisch sind sie vereint als Tote sans phrase, aber mit sehr viel Phrase werden sie zum Humus der Republik zusammengelogen: Die ist wie ein “Phallus aus der Asche” entsprungen und erhebt sich als Menhir gleich hinter dem sinnprallen Arsch eines transhistorischen Orpheus: Republica erecta est, komischerweise das einzig Weibliche in dem Spektakel. So was nennt man integrale Entsorgung.
Im Hrdlicka-Denkmal, das mit Recht so heißt, zwinkert in der Anklage schon die Versöhnung mit. Es ist in Wahrheit bloß Theaterdonner und bramarbasierende Austrotümelei. Das haben seine Gegner noch nicht kapiert, aber später werden sie es ihm danken: jene nämlich, die den Juden knien ließen, denn die kamen durch kein enges Tor herein, die waren schon da und sind es als Typ noch immer, wie mancher Jude weiß, der U-Bahn fährt, und das Tor stand sperrangelweit offen. So entlastet das Denkmal, das sich als Anklage gibt, indem es die Schuld teils ins Ausland, teils ins Metaphysische schiebt. Die Gewalt, die es schildert, ist selber ein Torso: Es identifiziert die Täter nicht und differenziert nicht die Opfer. Die Begriffshauerei schafft nur verwaschene Bilder, die dem Begreifen eher hinderlich sind.
Zur Sinnstifterei hat es durchaus gepaßt, dass bei der Eröffnung auch zwei Priester sprachen, persönlich gewiss integere Leute, gleichwohl als Vertreter jener Kirchen, die den Antisemitismus jahrhundertelang gepredigt haben. Denn so wie diese heute gnädig den Juden die Hände reichen, sofern sie nur gute Juden sind und wieder an den Gott ihrer Väter glauben, so zimmert das Mahnmal die Extreme zusammen, sofern sie nur irgendwie staatstragend sind. Gute Menschen sind jene, die an einen Sinn im Transzendenten glauben, die konfessionelle Fraktion ist fast schon egal, aber der Rest ist gottloses Gesindel und hat keine Moral, das war die Botschaft, die sie verkündet haben.
Nichts zu reden hatten jene, mit denen auch heute kein Staat zu machen ist, wie sogenannte Asoziale, Schwule oder Zigeuner. In den KZs hatten sie eigene Winkel, aber Vertreter beim “Bedenken” hatten sie nicht. Als ein paar von ihnen murrten, hat sie wie eh und je die Polizei abgeführt. Sie haben die patriotische Andacht gestört, die Geschichte in Geschichtlichkeit und Metaphysik verdampfte. Wie die synthetische Archaik auf dem geschwätzigen Denkplatz, so raunte auch die ökumenische Liturgie seiner Eröffnung den sattsam bekannten Ursprungsmythos daher: dass aus dem Leiden der in Gott Gerechten die Republik entstanden sei.
In Wahrheit ist sie das Produkt von Großmachtpolitik, von russischen Panzern und B-17-Geschwadern, wie Konrad Liessman zu Recht geschrieben hat. Und ebeso wahr ist seine These, dass diejenigen, die 1938 gegen den Faschismus waren, notwendigerweise für den Krieg sein mussten. Denn nur so war Befreiung zu erhoffen, nicht duch irgendeine Wegbeterei – wobei die Oberbeter damals ohnehin zum Heil Hitler Amen sprachen. Dabei haben selbst wir Kinder damals, sicher auch Klein Hrdlicka, deren Eltern weder Heil Hitler noch Amen sagten, gewusst, dass die amerikanischen Bomber unsere Bomber waren, auch wenn wir uns bei den Bombardements in die Hosen schissen. Deshalb sind deren Opfer auch nur privat zu beweinen, nicht aber staatlich in eins mit den Opfern der Schergen, denn jene waren der Tribut dafür, dass die Schergen verschwanden. So lernt man Dialektik von klein auf, sie wurde uns sehr materialistisch “eingebleut”, in der hilflosen Mythologie des Denkmals ist sie verdrängt.
Was Erinnern wirklich ist, ohne pathetische Phrase, das kann man aus einem wunderbaren kleinen Buch erfahren, das fast am gleichen Tag erschien, an dem die Prominenz vor der Albertina sich ergreifen ließ. Gar nicht geschwätzig wie der behauene Stein und vor allem leiser, sagt es doch viel mehr von dem, worüber der angeblich zu denken gibt.
Eine Frau Mitte Fünfzig, die hier zu Hause ist und keine Heimat hat, erzählt darin ihre Lebensgeschichte. Sie erzählt sie bruchstückhaft und episodisch, ohne aufgesetzte Moral, unkonstruiert und mit zögernder Stimme, naiv und gar nicht “sentimentalisch”, aber mit unendlicher Zärtlichkeit für die Menschen und Dinge, die sie umgeben und die sie begleitet haben. Sie erzählt fast schamhaft und ohne modische Betroffenheitsattitüde, sie drängt sich auf kein Zeitzeugenpodest, und vielleicht hätte sie nie gesprochen, hätte nicht Karin Berger, die das Buch herausgegeben und informativ, doch sehr zurückhaltend eingeleitet hat, sie dazu bei vielen Zusammenkünften ermuntert.
So ist es beiden Frauen zu danken, dass nach rund einem halben Jahrhundert der erste persönliche Bericht von einer Angehörigen eines Volkes vorliegt, dessen Ausrottung heute fast vergessen ist und schon damals kaum wahrgenommen wurde, obwohl eine halbe Million von ihm der Vernichtungsmaschinerie zum Opfer fiel; eines Volkes, das immer noch eine “Sonderbehandlung” erfährt. Gut genug für die Folklore, in der der Spießer seine Freiheit träumt, aber ohne Platz in unserer “offenen” Gesellschaft: Ceija Stojka ist Zigeunerin. Also ein Mensch, den man hierzulande nur auf der Opernbühne ästimiert.
Als achtjähriges Mädchen wurde sie 1941 gemeinsam mit ihrer Mutter und ihren fünf Geschwistern aus Wien deportiert. Nach Auschwitz zunächst, wo ihr kleiner Bruder starb, dann nach Ravensbrück, dann nach Bergen-Belsen. Ihren Vater hatten sie vorher schon in Dachau erschlagen. Der Rest ihrer Familie hat überlebt, nicht durch ein Wunder, sondern durch Zufall. Und durch Mut und gegenseitige Hilfe, durch Intelligenz und einen Lebenswillen, wie sie nur ein Volk besitzen kann, das sonst nichts besitzt, das über Jahrhunderte in kleine Gruppen vereinzelt war, das wie keine anderes die Freiheit liebte und daher niemals Macht besaß und auch keine wollte. Deshalb hat man es beim “Bedenken” auch vergessen, denn Moral ist eine Funktion der Gegenmacht.
Im Frühjahr 1945 wurde Ceija, damals gerade zwölf Jahre alt, von der britischen Armee befreit. Mit dem übriggebliebenen Rest ihrer Familie nach Wien zurückgekehrt, bekamen sie die Wohnung eines geflohenen Nazis zugeteilt. Doch nach der Entnazifizierung war der wie alle anderen wieder da und setzte sie auf die Straße. Das hat sich wiederholt. Praktisch obdachlos, besuchte sie ein Jahr lang die Schule. Dort hat sie, fast schon erwachsen, unter Siebenjährigen Lesen und Schreiben gelernt. Was sie sonst noch kann, hat sie sich selber beigebracht, und aus Erfahrung weiß sie mehr als ein Schock Ordinarien der Geschichte.
Man hat gesagt, Dante habe die Hölle nur als Tourist besucht auf seiner Reise durch die christliche Phantasmagorie. Ceija Stojka war eine der Verdammten. Sie hat auch keinen Vergil zum Begleiter gehabt, nur ihre Sippe, die zusammenhielt, und ihr Bericht ist kein Kunstwerk geworden. Aber wie wunderbar kann sie erzählen. Um nur eine der Szenen zu erwähnen, die unauslöschlich im Gedächtnis bleiben. Man wird im “Inferno” kaum eine Stelle finden von so schriller Bösartigkeit wie jene Weihnachtsfeier 1944 in Ravensbrück, welche die SS für die aus Angst und Hunger fast wahnsinnigen Kinder veranstaltet hat. Mit Christbaum, warmer Milch und Kuchen, mit “Stille Nacht, Heilige Nacht”, durchaus ernst gemeint. Bald darauf ging das Morden weiter, sie machten es dort mit Sterilisation. So lernt man den Sinn der christlichen Folklore kennen, viel besser als bei dem Christen Dante. Man sage nicht, die Mörder seien “Neuheiden” gewesen, auch wenn sie sich selber so verstanden, denn sie haben das Beste der christlichen Ideologie geerbt: die Sentimentalisierung der Bestialität.
Ceija Stojka ist der Hölle entronnen, aber was nachher kam, in Österreich, war auch keine zivilisierte Gesellschaft, allenfalls ein Purgatorium. Vierzig Jahre lang hat sie geschwiegen, hat in bescheidenen Verhältnissen gelebt, hat sich als Marktfahrerin durchgeschlagen und ihre Kinder großgezogen. Jetzt hat sie ihre Geschichte aufgeschrieben, weil das Schweigen um ihr Volk zu laut geworden ist, gerade im Geschwätz des “Bedenkens”. Es ist keine Elendsgeschichte geworden, sondern im Gegenteil eine des Stolzes, der Würde, der Noblesse. Und wenn es doch eine Elendsgeschichte ist, dann eine unseres Landes, in dem ihr Volk sich selbst verleugnen muss, um ohne Pöbeleien zu überleben, und das den Boden hier stärker liebt als seine patriotischen Ausverkäufer. So erzählt sie ihre Geschichte ohne Anklage und ohne Hass, fast ohne Bitterkeit. Aber so, dass man sich schämt für diesen Staat.
Am 12. März 1988 plädierte Bundeskanzler Vranitzky anlässlich einer Gedenkveranstaltung vor dem 1945 errichteten Mahnmal im Zigeuneranhaltelager Lackenbach (Burgenland) für eine rechtliche Gleichstellung der Zigeuner mit anderen Opfern der Nazis. Immerhin. Aber vor ihm ist keiner auf die Idee gekommen, rotz “Mahnmal”, vierzig Jahre lang, als auch noch Opfer lebten, die damals keine Kinder waren. Heute sind fast alle tot, und die Gleichstellung kommt billig – ideologisch und finanziell. So fragt man sich, wozu ein Mahnmal errichten, wenn es nicht einmal jene mahnt, die andere mahnen. Da ist es schon besser, man liest ein paar Bücher und fragt bei denen nach, die im Verborgenen leben.
Rudolf Burger, PROFIL, Februar 1989
(...) Der Bericht ist von einer Frau geschrieben, die trotz ihrer Kindheitseindrücke und der deprimierenden Erlebnisse im Nachkriegsösterreich selbstbewußt ist, stolz auf ihr Volk und die nicht länger schweigen will über sich und über die Gadje, die Nicht-Zigeuner.
Ch. G., EMMA, Aug. 1989
LEBEN IM VERBORGENEN
“Ja, ich wunder mich schon, ich wunder mich jeden Tag….Jeden Tag frag ich mich: Wieso bist du da, Ceija? Und bist nicht irgendwo verscharrt, wo man gar nicht weiß, wo du bist und dass du existiert hast.”
Was für ein Mensch ist das, der solche Fragen stellt?
Eine Frau. Eine Zigeunerin. Ceija Stojka, vom Stamme der Rom, geboren 1933. Geboren während eines Aufenthalts ihrer umherziehenden Familie unweit von Knittelfeld. Deportiert nach Auschwitz-Birkenau im neunten Lebensjahr, gemeinsam mit Mutter und Geschwistern; von dort – Anfang 1945 – ins Frauenlager Ravensbrück, zuletzt nach Bergen-Belsen. Ihr “Wunder”: Sie hat überlebt. Der Vater, der jüngste Bruder, überlebten nicht.
Wenn Ceija sich ihrer frühen Kindheit erinnert, der Zeit vor 1938, klingen Töne einer fast märchenhaften Freiheit und Gemeinschaftlichkeit mit. Die Zigeunerfamilien – ganze Familienverbände – ziehen mit ihren Wohnwägen im Land umher, die Männer handeln mit Pferden, die Frauen mit Spitzen und Stoffen. Manchmal liest die Mutter einer Bäuerin aus der Hand, dafür gibt es Mehl, Zucker oder Speck. Vielleicht auch ein Geschenk für die Kinder.
Manchmal, bei Schlechtwetter, läßt ein Bauer sie den Wagen auf seinem Hof unterstellen, meist jedoch lagern sie in freier Natur. Die Kinder spielen auf den Wiesen und Feldern, lauschen den seltsamen Geschichten der Großmütter oder vergnügen sich mit dem Vater auf dem Fußballplatz. Dort und im Umgang mit den Kindern der gadje (Nichtzigeuenr) lernen sie – neben ihrer angestammten Sprache, dem Romanes – von klein auf auch Deutsch.
Von einer Diskriminierung war damals – im geborgenen Raum der Großfamilie – für Ceija noch wenig spürbar: Zwar entgeht ihr nicht, dass ein Teil der Leute Tür und Fenster vor ihnen verschließt, jeden Kontakt verweigert. Doch überall gibt es auch andere, Freundliche, die das Gespräch oder Tauschgeschäfte suchen, die die Neugier und Kontakfreude ihrer Kinder gegenüber dem fremdartigen Volk nicht beschneiden.
Was in Ceija verwurzelt bleibt, sind die Liebe und Fürsorge der Eltern, der Zusammenhalt unter den verwandten Zigeunerfamilien, das Gefühl der Freiheit in freier Natur und das Selbstbewusstsein, eine Zigeunerin, sie selbst zu sein: “Du bist du, Ceija”, sagte die Mutter des Öfteren zu ihr, “Du darfst keine andere sein, du mußt immer schauen, dass du deine Art, die dir der liebe Gott gegeben hat, behältst, und dass du sagst: Ich bin ich, was willst du von mir?” – Wenn man das nicht ist, wird man ein Mauerblümchen und kann aus seinem Leben nichts machen. Hätte ich mich immer verkrochen, wo wäre ich hingekommen? Wär ich wahrscheinlich in Auschwitz geblieben. Aber so hab ich immer geschaut, wo gibt es eine Kartoffel, wo könnt ich ewas organisieren, wo ist einer gestorben in einer Buchse, der noch dein Stückl Brot bei sich liegen hat. Das hab ich genommen, er hat es ja nicht mehr gebraucht, er wird mir nicht böse gewesen sein.”
Du darfst keine andere sein. In einem ganz anderen Sinn hat der Nationalsozialismus diesen Satz gebraucht: zur Entwertung, zur Aussonderung all jener, die den Vorstellungen der Machthaber von Reinrassigkeit und “Normalität” nicht entsprachen, denen keine exakt kontrollierbare und “produktive” Rolle zuzuweisen war in ihrem exakt kalkulierten ökonomischen Ausbeutungssystem. Als “asozial”, “arbeitsscheu” und “kriminell” wurden sie in Konzentrationslager eingewiesen, 1942 war der Beschluss zur endgültigen Vernichtung der Roma und Sinti gefasst.
Wie oft in dieser Zeit hat die Wissenschaft Handlangerdienste geleistet: etwa mit dem Versuch des Zigeuner-“Forschers” Dr. Ritter, die (behauptete) “Asozialität” dieser Volksgruppen als genetisch (!) bedingt nachzuweisen…
Diskriminierte, verfolgte Aussenseiter waren die Rom-Zigeuner von Anfang an. Seit sie – im 14./15. Jahrhundert – aus Nordindien nach Europa eingewandert waren. Zunächst vor allem von Kirche und Handwerkszünften – aus Gründen ökonomisch und ideologisch begründeter Konkurrenzgefühle – an den Rand der Gesellschaft gedrängt, später vom absolutistisch regierten Staat und der in seinen Grenzen sich formierenden Industriegesellschaft. Deren Profit- und Leistungsinteressen schien die freie Lebensweise dieses Volkes nicht akzeptabel, gefährlich wohl vor allem in seiner möglichen Vorbildwirkung auf andere: das aufstrebende Industriesystem brauchte Arbeitskräfte in hoher Zahl und wollte jede (ausbeutbare) Kraft unter seiner Kontrolle wissen.
Als die Versuche der Vertreibung und physischen Vernichtung nicht zur Gänze funktionierten, ging der Staat zu einer Politik der Assimilation über, aber auch auf diese Weise gelang es nicht, die Identität dieses Volkes, die Eigenart ihrer Lebensweise zu zerstören. Erst der Vernichtungspolitik des Nationalsozialismus in Verbindung mit der nachfolgenden Ignoranz und Gleichgültigkeit der “Wiederaufbau”-Gesellschaft, der fortgesetzten Diskriminierung in fast allen Bereichen des Lebens dürften wesentliche Schritte in diese Richtung gelungen sein.
500 000 Roma und Sinti fielen der Mordpolitik des NS-Regimes zum Opfer, mehr als die Hälfte der früher in Österreich lebenden kam nicht mehr aus den Lagern zurück. Einige ihrer Siedlungen waren nach 1945 vollständig ausgerottet, manche zählten nur mehr ein Drittel der Bewohner….
“Auschwitz hab ich ein zweites Mal erlebt”: Ceija Stojka zur Entstehungsgeschichte ihrer Aufzeichnungen, die im vergangenen Monat im Picus-Verlag erschienen sind. Ein seltenes Dokument, die erste Autobiographie einer Rom-Zigeunerin. Keine Selbstverständlichkeit für eine wie Ceija, die kaum viel mehr als ein Jahr in der Schule zugebracht hat – unter den Nazis war ihr der Schulbesuch untersagt, nach dem Krieg haben die Umstände ihre Familie bald wieder zum “Wandern” gezwungen. Trotzdem hat sie sich das Lesen und Schreiben z.T. im Selbststudium beigebracht, hat Jahrzehnte danach das Schweigen gebrochen.
Ein Schweigen, das insbesondere die Vernichtungspolitik gegenüber den Zigeunern einhüllt, der Kenntnis der Öffentlichkeit entzieht. Ein Schweigen der Nichtbetroffenen – aus Desinteresse, Abwehr und Ignoranz. Ein Schweigen auch unter denen, die Opfer waren, aus Angst, die Erinnerung nicht zu ertragen, im Zurückschauen all den Gräueln wieder ausgesetzt zu sein.
Ceija aber hätte die Kommunikation zur Bewältigung ihrer Erlebnisse im KZ gebraucht. Als sie ihr verwehrt bleibt, greift sie zu Bleistift und Papier – allen Schwierigkeiten und Widerständen ihrer Lebensumstände zum Trotz: “So hab ich immer die Zeit ausnützen müssen, wenn ich allein war. Eine halbe Stunde hab ich meistens geschrieben, dann musste ich ja schon wieder kochen. Während ich aber gekocht oder das Essen serviert oder Geschirr abgewaschen hab, hat sich das in mir wieder gespeichert, in meinen Gedanken war ich schon wieder am Papier. Und wie ich dann wieder Zeit gehabt hab, ist das fließend herausgekommen.”
Der erste Schock: Eines Tages wird der Vater weggeführt – auf Nichtmehrwiedersehen. Ein zweiter Schock: Ceija muss, als Zigeunerkind, die Schule verlassen. Schon vorher, seit 1939, war der Lebensraum immer enger geworden: Damals wurde den Zigeunern in Österreich das Umherziehen verboten, Zwangsumsiedlungen auf Sammelplätze setzten ein, 1940 beginnt die Konzentration in KZ-konforme Internierungs- und Arbeitslager – Lackenbach, Maxglan, Weyer.
1939 zieht Ceijas Vater mit seiner Familie nach Wien, baut den Wohnwagen zu einer kleinen Holzhütte um, nahe dem Kongreßpark, in einem Hof im 16. Bezirk. Die materielle Versorgung der Familie wird immer schwieriger, auch die Kinder helfen mit. Nach dem “Verschwinden” des Vaters in Dachau beginnt die Zeit der häufigen Razzien, die Zeit der ständig wechselnden Verstecke: bei Bekannten und Verwandten, im Gebüsch und unter den Laubhügeln des Kongreßparks. Eine der älteren Schwestern wird ins Gefängnis und von dort nach Lackenbach gebracht, und eines Tages, um sieben Uhr früh, rüttelt die Gestapo die Kinder aus den Betten: der Weg nach Auschwitz beginnt.
Wenn Ceija über diese Zeit schreibt, mischt sich der Blick der Erwachsenen Frau, die ihren Erinnerungen nachgeht, mit den Augen des Kindes von damals: einem Kind, drei Jahre lang in der Hölle eingeschlossen, ständigem Hunger, ständiger Kälte, Angst und Schwerarbeit ausgesetzt, Tag für Tag zwischen Sterbenden, wachsenden Leichenbergen und rauchenden Krematorien, von denen jeder – auch jedes Kind – wußte, was sie bedeuten, über die aber nicht geredet werden darf.
“Ist hier die ganze Welt?” fragt sie eines Tages die Mutter und kann sich nicht vorstellen, dass irgend was und irgend jemand noch außerhalb existiert. Dass es Wien, ihre letzte Heimat, noch gibt. In diesem – systematisierten – Chaos von Schlägen, Krankheit und Mord nicht unterzugehen, bedurfte es vieler glücklicher Zufälle – Ceija hat einen anderen Begriff dafür: Gott.
Trotzdem wäre Rettung nicht möglich gewesen ohne die Fürsorge und Überlebens-Tüchtigkeit der Mutter (die in jeder Situation noch ein Lebens-Mittel findet, und seien es die essbaren Blätter eines Bauens) und ohne den Zusammenhalt unter den Zigeunerfrauen. Vor allem aber nicht ohne das Selbstvertrauen, den Mut und die Geschicklichkeit des Kindes selbst. Sein schlimmstes Erlebnis muss der Tod des kleinen Bruders gewesen sein, den Ceija – unter Lebensgefahr – bis zuletzt zu bereuen und zu trösten sucht, den sie schließlich unter einem Berg von Toten entdeckt, um den zu trauern ihr aber – unter Prügeln – verboten wird.
Als “glücklicheres” Bild bleibt die Szene im Gedächtnis, als Ceija von der SS in Auschwitz auf die linke, auf die Seite derer aussortiert wird, die für die Gaskammer bestimmt sind. Mit Hilfe der Mutter und Geschwister, durch eine falsche Altersangabe und den demonstrativen Nachweis ihrer Arbeitstüchtigkeit gelingt es ihr, die Seite zu wechseln.
Ein “Gück” dessen Schatten vielleicht in alles künftige Glück hineinreichen wird:”Ich schaute nach links und sah meine zwei Tanten mit ihren Kindern dort stehen: Malla und Kurti, sieben Jahre, und Tante Rosi mit ihrem Baby, das im KZ geboren war. Und meine liebe Polin, sie winkte zu uns herüber, sie alle waren zum Tod verurteilt. Wir werden sie nie wiedersehen”
Wir leben im Verborgenen: der Titel des Buches. Ein Satz, mit dem die Rom-Zigeunerin das Dasein ihres Volkes zusammenfasst. Im Zentrum ihrer eigenen Aufzeichnungen steht das KZ-Erlebnis, ein ausführliches Interview der Herausgeberin mit Ceija Stojka spannt den weiteren Lebensbogen: Erinnerungen an die frühe Kindheit, an die Zeit nach Kriegsende. Das kurze Glück, in einer ehemaligen Naziwohnung unterzukommen – nach einigen Monaten wird die Zigeunerfamilie vertrieben, die Nazis sind wieder da. Die Rückkehr in den Wohnwagen, zur fahrenden Lebensweise. Ceija kämpft sich, ausgeschlossen vom Wiederaufbauwunder, durch die fünfziger Jahre, als Mutter von drei Kindern; mit Stoffen handelnd, von Tür zu Tür, später auf Märkten. Aus der hart erkämpften Hinterhofwohnung, einer ehemaligen Waschküche, wir sie delogiert. Der Zigeunerin bleibt als einziger, nach Abriss des Hauses, die Ersatzwohnung verwehrt.
Von Diskriminierung erzählt Ceija, von den nach wie vor lebendigen Vorurteilen und ihrem Hintergrund. Aber auch von fröhlichen Aspekten des Marktfahrens, den Festen der Rom, ihrer Lebensart, die sie mit Attributen wie “gütig, verträumt und stolz” umschreibt.
Lotte Podgornik STIMME DER FRAU, November 1988
NOTES DE LECTURE
Avec Je rêve que je vis ?, Nous vivons cachés (de nouveau traduit par Sabine Macher) permet au public francophone de découvrir l’ensemble des écrits de témoignage de Ceija Stojka publiés de son vivant. Paru en Autriche en 2013, pour les quatre-vingts ans de son auteure, ce volume rassemble les récits écrits par Ceija Stojka et originellement publiés en 1988 et 1992, revus et enrichis par Karin Berger (réalisatrice et documentariste autrichienne qui a accompagné Ceija Stojka tout au long de son travail de mémoire) de deux poèmes de Ceija, deux entretiens menés avec elle en 1987 et 1992 et d’un témoignage sur l’importance de cette rencontre.
Dans les deux premiers chapitres, « C’est ça le monde ? » et « Voyage vers une nouvelle vie », les souvenirs se concentrent sur l’effarement de l’enfant déportée, sa vision du monde basculé dans l’horreur des camps de concentration, mais aussi sur la vie d’avant (les planques dans la Vienne occupée) et de l’après-déportation (le long voyage de retour à Vienne, les retrouvailles avec les autres membres de la famille et le monde des Gagjé, plus ou moins bienveillants, l’adversité de ce retour dans l’indifférence, sinon l’hostilité, de l’administration autrichienne après guerre). Puis nous découvrons l’adolescente ayant retrouvé la liberté—et les difficultés—de la vie itinérante de sa famille à travers l’Autriche, et la jeune et moins jeune femme, au fil des décennies, se battant pour vivre décemment avec trois enfants à charge.
Les entretiens, quant à eux, permettent d’entrer plus avant, au gré d’anecdotes plus ou moins heureuses, dans la vie de cette femme bouleversante d’humanité, son quotidien, sa traversée du siècle, appuyée sur les traditions de son peuple. Enfin, « Voyages dans la Kaiserstrasse » de Karin Berger contextualise les récits de Ceija, tout en apportant une expérience intime de cette histoire (avec un petit et avec un grand H), évoquant son propre voyage dans l’univers rom, et dans cet « entre mondes » dont l’appartement de Ceija était devenu le symbole.
La singularité de Je rêve que je vis ? tenait au ton de la narration, qui parvenait à faire entendre, littéralement, la petite fille derrière la femme âgée qui racontait. Ici, elle se souvient, avec une fraîcheur et une précision saisissantes. Présent et passé ne cessent de se télescoper, tantôt portés par la fillette tantôt par l’adulte, naïveté et lucidité mêlées — une voix éminemment libre et singulière, que la traduction de Sabine Macher rend avec une grande justesse de ton. Loin de n’évoquer que la douleur et l’âpreté du passé, elle est portée, et nous porte avec elle, par un amour inconditionnel de la vie. Comme l’a noté Der Spiegel à la sortie du livre en Autriche, Ceija, « sans sentimentalisme, imperturbable et terriblement juste », est « une femme fière, et forte ; ses livres s’érigent contre l’oppression et le silence ».
Alors qu’en Europe les populations errantes, et parmi elles toujours les Roms, subissent les politiques menées contre elles, tout rappel historique, par exemple sous forme de témoignage, est opportun. C’est tardivement que Ceija Stojka, issue d’une famille de marchands de chevaux rom d’Autriche, a commencé à consigner ses souvenirs. D’abord sur des bouts de papiers qu’elle gardait dans sa cuisine, puis les réunissant. Elle avait tenu à apprendre à lire et écrire pour ne pas avoir à signer de trois croix, comme le faisait sa mère. Autrefois tout le bagage mnémonique voyageait par les récits des anciens et les chansons singulières que beaucoup connaissaient…
Jean-Claude Leroy, Blogs. Mediapart, 6 mars 2018
Il faut savoir gré aux éditions isabelle sauvage de nous faire découvrir en français l’œuvre complète de Ceija Stojka. Après Je rêve que je vis ?, la publication de Nous vivons cachés – Récits d’une Romni à travers les siècles, permet de retrouver la voix singulière d’une rescapée des camps de concentration allemands (Auschwitz, Ravensbrück, Bergen-Belsen), née en Styrie (Autriche) d’une famille de marchands de chevaux rom, dont le père mourut à Dachau. […]
Sans pathos, ni haine, son témoignage révèle la foi en la vie d’une femme que le destin a choisi pour dire sans détour à tous, les siens et les Gadjé, ce qu’a été l’oppression nazie, alors qu’arrivent de nouveau au pouvoir des êtres de rancœur extrême.
Fabien Ribery, « Ceija Stojka, numéro Z 6399 tatoué à Auschwitz, et rescapée », L’Intervalle, 9 mars 2018
Une parole importante, comblant le vide, l’invisibilité historique construite des populations Roms et Sinté en Europe et de leur destruction par les nazis.
Didier Epsztajn, « Mais on peut aussi porter le deuil sans une robe noire », Entre les lignes entres les mots, 16 mars 2018
Ce qu’elle [Ceija Stojka] rapporte, sans doute l’a‑t-on déjà lu dans d’autres témoignages mais, outre que les écrits des rescapés de la communauté romani sont rares, il est nécessaire que ces temps où des hommes en détruisaient d’autres au nom d’une imaginaire pureté raciale ne soient pas oubliés. […]
Sabine Macher avait traduit, pour le même éditeur, Je rêve que je vis ? Libérée de Bergen-Belsen (2016) et elle restitue avec bonheur la précision et la simplicité de l’écriture de C. S. Un livre à introduire dans toutes les bibliothèques publiques et scolaires.
Tristan Hordé, Sitaudis.fr, 21 mars 2018
Elle [Ceija Stojka] dit elle-même que lorsqu’elle a commencé à écrire ce récit, “les souvenirs me sortaient en trombe. Après je me suis dit : voici la vérité, tout est accompli.” Le ton du livre est donné : il s’agit de raconter ce qu’a vu et ressenti une enfant d’une douzaine d’années, condamnée à disparaître dans les camps de la mort, parce que née rom. Elle n’a rien oublié. L’écriture permet à Ceija de nommer les atrocités subies par la petite fille qu’elle était, et elle trouve dans le langage le moyen de donner forme à ce chaos dans lequel elle avait été précipitée. Elle s’appuie sur la vue de ce qu’elle a vécu pour nourrir son travail d’écriture avec les sensations d’une petite fille de douze ans, et ce témoignage est d’autant plus fort que nous restons toujours à la hauteur des yeux de cette enfant qui subit la violence des évènements et nous les restitue habillés d’uniformes, de bottes, de mitraillettes, blocs de cruauté qui ont pouvoir de vie ou de mort sur les prisonniers des camps de concentration. Chaque instant vécu par Ceija est une lutte perpétuelle pour la survie, et c’est de l’intérieur de chacun de ces instants qu’elle nous décrit la vie des camps avec l’intensité terrible de celle qui peut disparaître dans la minute suivante et qui donne à ce qui l’entoure une éternité fugace dont elle garde la mémoire.
Vianney Lacombe , Poezibao, 26 mars 2018
On doit saluer la richesse de cet ouvrage qui fourmille d’informations sur le mode de vie rom en Autriche avant la guerre, les rapports avec les Gadjé, la progressive détérioration des conditions de vie lorsqu’en 1939 les Tsiganes n’étaient plus autorisés à voyager : “Ce qu’il fallait pour vivre s’est rétréci de plus en plus.” Nous vivons cachés est aussi un extraordinaire et rare témoignage sur la déportation des Tsiganes en différents camps, ainsi que leur libération.
Les récits de Ceija Stojka sont tout à fait personnels en ce qu’ils sont les récits d’une vie : ses rapports avec ses parents et sa famille, puis, de retour des camps, la manière dont la famille se reconstruit autour de la famille maternelle, les émois amoureux et sa propre maternité, très précoce. […]
La rencontre avec la documentariste Karin Berger, qui rassemble alors des témoignages sur les camps de concentration, et l’amitié profonde qui s’en est suivie, sont sans aucun doute déterminantes. Et Ceija Stojka, vendeuse de tapis dans des foires, est la première femme rom à témoigner du génocide des Tsiganes. Ce qui ressemble pour son entourage à des “gribouillis”, l’écriture à laquelle elle décide de se consacrer, pendant des demi-heures volées, dans sa cuisine, en cachette, devient une nécessité vitale : “Mais en cuisinant ou en servant le repas ou en faisant la vaisselle, ça recommençait à s’accumuler en moi, dans ma tête j’étais de nouveau devant la page. Et dès que j’avais du temps, ça coulait tout seul.” Les récits font entendre une voix propre, une voix au plus près des réalités qu’elle entend donner à voir aussi, dans une syntaxe parfois déconcertante, au plus près sans doute de la voix de l’enfant qu’elle fait revivre par l’écriture.
Gabrielle Napoli, « Le manteau de Ceija Stojka », En attendant Nadeau, 10 avril 2018
Certains soirs où l’impuissance a fini de nous désarmer, on aimerait s’asseoir dans une cuisine toute simple, mettre les bras sur la table, jouer négligemment avec un mug bien chaud et écouter une femme, une mère, pleine de bon sens, de force et de calme, nous parler autrement de la vie.
La magie de Nous vivons cachés de Ceija Stojka est de créer dès le premier mot cette atmosphère de confession intime et universelle dont on sait à l’avance qu’elle seule peut nous apporter le remède à nos carences. Le tragique et le merveilleux se mêlent dans l’autobiographie de la conteuse ; celle-ci nourrissant dans le même temps le lecteur de ses engagements : intelligence de ceux qui parviennent à survivre au cœur de l’enfer, persévérance et combativité, élégance de ceux qui transforment un destin épouvantable en art de vivre puis en art tout court. […]
Balval Ekel, La Cause littéraire, 6 juin 2018
Si les récits de Ceija Stojka sont poignants, ils restent toutefois empreints d’une grande humanité, dans un monde qui en manquait cruellement. Elle dit la dureté, les coups, la faim, les déplacements d’un camp à l’autre mais également les liens forts qui existaient entre ceux et celles qui tentaient de survivre dans cet enfer et la foi chrétienne qui leur permettait souvent de tenir bon. […]
Ce dont ne se doute pas Ceija Stojka – qui est également peintre – en témoignant ainsi, guidée par la documentariste Karin Berger (qui l’aura accompagnée – et souvent enregistrée – tout au long de son travail), c’est l’impact qu’aura son livre à parution, en 1988. Sa force, la fraîcheur de sa voix, le sens du détail, sa façon de dépasser l’anecdote pour aller à l’essentiel et la lucidité qui émane de ses textes y sont pour beaucoup. Elle deviendra rapidement l’ambassadrice de la communauté rom en Autriche et bien au-delà.
Jacques Josse, Remue.net, juin 2018